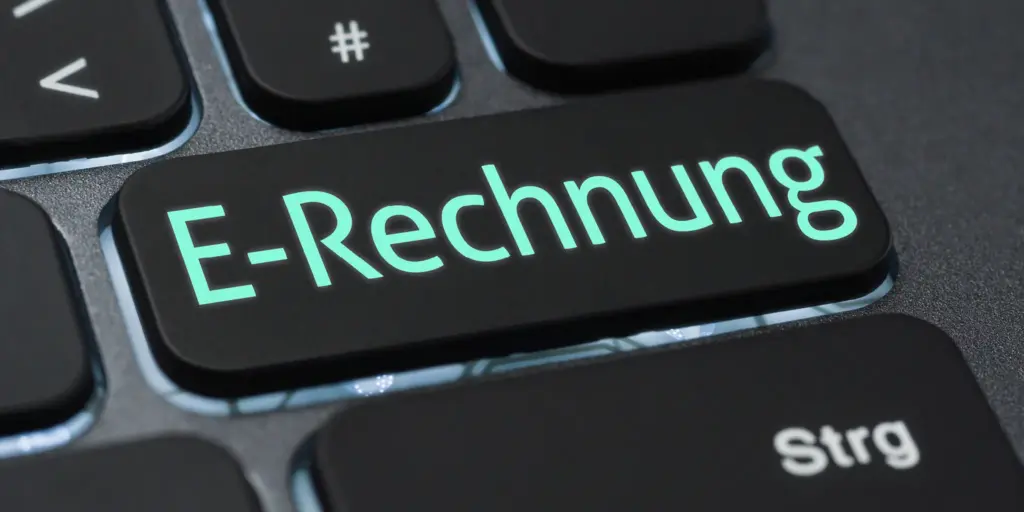Neues von der E-Rechnung
BMF veröffentlicht neues Schreiben
Für Leistungen zwischen umsatzsteuerlichen Unternehmern wurde in Deutschland zum 1. Januar 2025 die E-Rechnungspflicht eingeführt. Seit diesem Zeitpunkt müssen alle Unternehmer E-Rechnungen empfangen können. Für die Ausstellung von E-Rechnungen gibt es Übergangsfristen. Die Finanzverwaltung gibt in ihren Schreiben Hilfestellung für den Prozess der Umstellung.
Die Finanzverwaltung hat das E-Rechnungs-Schreiben erneut überarbeitet und den Umsatzsteuer-Anwendungserlass entsprechend angepasst. Für Unternehmen zählt nun, was sich gegenüber dem Schreiben vom 15.Oktober 2024 und dem Entwurf vom 25.06.2025 tatsächlich ändert – und wo Prozesse nachgeschärft werden sollten. Der Anwendungszeitraum bleibt unverändert: maßgeblich sind Umsätze ab dem 1. Januar 2025; Übergangsregelungen laufen bis zum 31. Dezember 2027.
Was ist neu im Vergleich zu 2024 und dem Entwurf 2025?
Gegenüber 2024 und dem Entwurf 2025 rückt die Verwaltung stärker die technische und inhaltliche Qualität der E-Rechnung in den Mittelpunkt. Neu ist vor allem die deutliche Abgrenzung von Fehlerarten, die präzisere Ausgestaltung der Leistungsbeschreibung im strukturierten Datenteil sowie klarere Hinweise zum Empfang und zur Archivierung. Einzelne Praxisfragen – etwa zu wiederkehrenden Leistungen – werden verbindlicher gefasst.
Formatfehler und Geschäftsregeln klar getrennt
Die Verwaltung trennt nun ausdrücklich zwischen Formatfehlern und Geschäftsregelfehlern. Ein Formatfehler liegt vor, wenn die Datei einer zulässigen Syntax nicht entspricht oder sich der Inhalt nicht korrekt und vollständig extrahieren lässt. Dann liegt keine E-Rechnung vor, sondern eine sonstige Rechnung in einem anderen elektronischen Format. Geschäftsregelfehler betreffen demgegenüber Verstöße gegen die in der jeweiligen Syntax vorgesehenen Prüfregeln. Unternehmen dürfen sich – bei Beachtung kaufmännischer Sorgfalt – auf das Ergebnis einer geeigneten Validierung stützen. Diese Klarstellungen gehen über das BMF-Schreiben aus 2024 hinaus und schärfen den Entwurf aus 2025 nach.
Pflichtangaben im strukturierten Teil
Die Pflichtangaben müssen im strukturierten Datenteil stehen, damit der Inhalt maschinell verarbeitet werden kann. Ergänzende Details – etwa Stundennachweise oder Spezifikationen – dürfen als Anhang mitgegeben werden, ersetzen aber Pflichtfelder nicht. Die Verwaltung erläutert die Anforderungen an eine eindeutige, leicht nachprüfbare Leistungsbeschreibung nun ausführlicher als 2024 und präziser als im Entwurf.
Empfang und Zustimmung
Unternehmen müssen technisch in der Lage sein, E-Rechnungen zu empfangen. Eine gesonderte Postfachlösung ist nicht erforderlich; eine erreichbare E-Mail-Adresse genügt. Verweigert der Empfänger den Empfang oder ist er technisch nicht bereit, entsteht grundsätzlich kein Anspruch auf Ausstellung einer sonstigen Rechnung. Außerhalb der E-Rechnungspflicht bleibt es dabei, dass für sonstige elektronische Rechnungen eine – auch formlose – Zustimmung benötigt wird. Gegenüber 2024 ist der Wortlaut konkreter, gegenüber dem Entwurf wurden Aussagen konsolidiert.
Gutschriften und typische Pflichtfälle
Bestätigt wird, dass die Pflicht zur E-Rechnung auch für Gutschriften gilt. Ebenso bleibt es bei den bereits bekannten Pflichtfällen, etwa bei inländischen Reverse-Charge-Konstellationen und bestimmten Sonderregelungen. In der Sache gibt es hier keine Ausweitung gegenüber 2024; die Endfassung übernimmt die Linie des Entwurfs.
Wiederkehrende Leistungen: Nummerierung praxistauglich
Für Dauerschuldverhältnisse, z. B. Mietverhältnisse, bringt das Schreiben eine praxisnahe Präzisierung: Eine einmalige E-Rechnung zu Beginn kann genügen. Außerdem kann eine im Vertrag enthaltene eindeutige Kennung – etwa eine Objekt- oder Mieternummer – als Rechnungsnummer ausreichen. Diese Handhabung war 2024 so nicht ausdrücklich formuliert und wird gegenüber dem Entwurf verbindlich im Anwendungserlass verankert.
Archivierung des strukturierten Teils
Der strukturierte Teil einer E-Rechnung ist unverändert im empfangenen Format zu archivieren. Für Zwecke der Umsatzsteuer gilt weiterhin: Eine Speicherung außerhalb eines GoBD-Systems ist für sich genommen kein Verstoß; andere Vorschriften bleiben unberührt. Neu ist die breitere Darstellung zu Echtheit, Unversehrtheit und Lesbarkeit sowie zusätzliche Verweisstellen im Anwendungserlass. Damit wird der Abschnitt praxisnäher als 2024 und stringenter als im Entwurf.
Was Unternehmen jetzt tun sollten
Es empfiehlt sich, die Validierung verbindlich vor Versand und beim Eingang festzulegen und die Berichte zu dokumentieren. Vorlagen sollten so angepasst werden, dass alle Pflichtangaben im strukturierten Datenteil vollständig enthalten sind. Externe Links, die Pflichtfelder ersetzen sollen, werden am besten entfernt.
Für den Empfang genügt eine organisatorisch saubere Lösung mit erreichbarer E-Mail-Adresse. Intern sollten Zuständigkeiten und Ausfallszenarien festgehalten werden. Bei wiederkehrenden Leistungen bietet es sich an, vertragliche Kennnummern als Rechnungsnummer konsequent zu nutzen und dies in den Prozessen zu hinterlegen.
In der Buchhaltung helfen klare Routinen: Entgeltminderungen werden über die laufende Umsatzsteuer-Korrektur abgebildet, während Leistungsänderungen durch eine E-Rechnungs-Berichtigung nachvollzogen werden. In Branchen mit umfangreichen Anlagen oder Stundennachweisen – zum Beispiel Bau, Handwerk oder Beratung – unterstützt eine knappe, eindeutige Leistungsbeschreibung im strukturierten Datenteil, während Detailangaben in den Anhang wandern.
In Bereichen mit wiederkehrenden Leistungen – etwa Vermietung oder Telekommunikation – schafft die Nutzung vertraglicher Kennnummern als Rechnungsnummer zusätzliche Stabilität. Abschließend lohnt ein kurzer Archiv-Check: Der strukturierte Teil sollte unverändert, maschinell auswertbar und dauerhaft lesbar gespeichert sein.
Fazit
Die Endfassung des BFM-Schreibens zur E-Rechnung vom 15. Oktober 2025 bestätigt bisherige Sichtweisen, formuliert aber eindeutiger und grenzt klarer ab: Technische Formate und Geschäftsregeln werden sauber getrennt, die Leistungsbeschreibung im strukturierten Teil wird verbindlicher, Empfang und Archivierung werden praxistauglich konkretisiert. Wer bereits auf Basis des Entwurfs umgestellt hat, sollte nun Validierung, Leistungsbeschreibung und Nummerierung ergänzen. Wer noch gemischte Prozesse nutzt, sollte in diesen Punkten gezielt nachbessern. Gegenüber 2024 liefert das Schreiben mehr Verbindlichkeit und mehr Alltagstauglichkeit – mit überschaubarem Nachjustier-Bedarf in den Prozessen.